Regenerative Praxis
Der Begriff der regenerativen Landwirtschaft wurde bereits in den siebziger Jahren durch den amerikanischen Biopionier Robert Rodale geprägt. Im Gegensatz zum Biolandbau ist regenerative Landwirtschaft jedoch nicht durch ein Regelwerk normiert. Der Ansatz der regenerativen Landwirtschaft zielt darauf ab, die Gesundheit von Böden, Ökosystemen und Gemeinschaften zu fördern. Insgesamt bietet die regenerative Landwirtschaft eine vielversprechende Lösung für einige der drängendsten Herausforderungen der modernen Landwirtschaft, indem sie ökologische, ökonomische und soziale Aspekte miteinander verbindet.
Regenerative Praktiken wie Fruchtwechsel, Deckfrüchte und reduzierte Bodenbearbeitung tragen dazu bei, die Bodenstruktur zu verbessern und Erosion zu verhindern. Regenerative Landwirtschaft fördert die Biodiversität, indem sie bewusst Lebensräume für verschiedene Pflanzen- und Tierarten schafft.
Ein zentrales Ziel der regenerativen Landwirtschaft ist die Kohlenstoffbindung im Boden. Durch die Verbesserung der Bodenqualität können Landwirte dazu beitragen, CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Auch die Permakultur ist eine regenerative Praxis.
Eine Landwirtschaft im Sinne der Permakultur schafft und arbeitet mit vernetzten Ökosystemen und setzt auf kleinräumige und standortangepasste Anbausysteme – ist quasi geplantes Chaos. Einjährige neben mehrjährigen Pflanzen, Gemüse in und neben Getreide, daneben Obstbäume und Beerensträucher sowie Hecken und Tümpel (und auch Nutztiere) lassen sich problemlos in ein Permakultursystem integrieren. Verschiedene Kulturen und Nutztiere wechseln sich ab, wachsen und gedeihen durchmischt nebeneinander, ergänzen und unterstützen sich: So kann Kapuzinerkresse Schädlinge wie Blattläuse von den Obstbäumen fernhalten, Ringelblumen und Meerrettich können die Krankheitsresistenz von Obstbäumen verbessern und Freilandschweine bereiten den Boden für nährstoffhungrige Pflanzen. Permakultur nutzt die natürlichen und lokalen Ressourcen und formt sie zu landwirtschaftlich produktiven, selbsterhaltenden Ökosystemen. Mit der Vernetzung der einzelnen chaotischen Bereiche wird in der Folge die Biodiversität und Kreislaufwirtschaft gefördert sowie die Umwelt und die Ressourcen geschont. Die Permakultur hat eine enorm hohe Flächenproduktivität und übertrifft andere Anbausysteme wenn man Kalorien pro Hektare vergleicht. Zurzeit grösstes Defizit ist die hohe Arbeitsintensität, Permakultur gilt als unwirtschaftlich. Die Arbeit im gewollten Chaos bedarf noch der Handarbeit.

























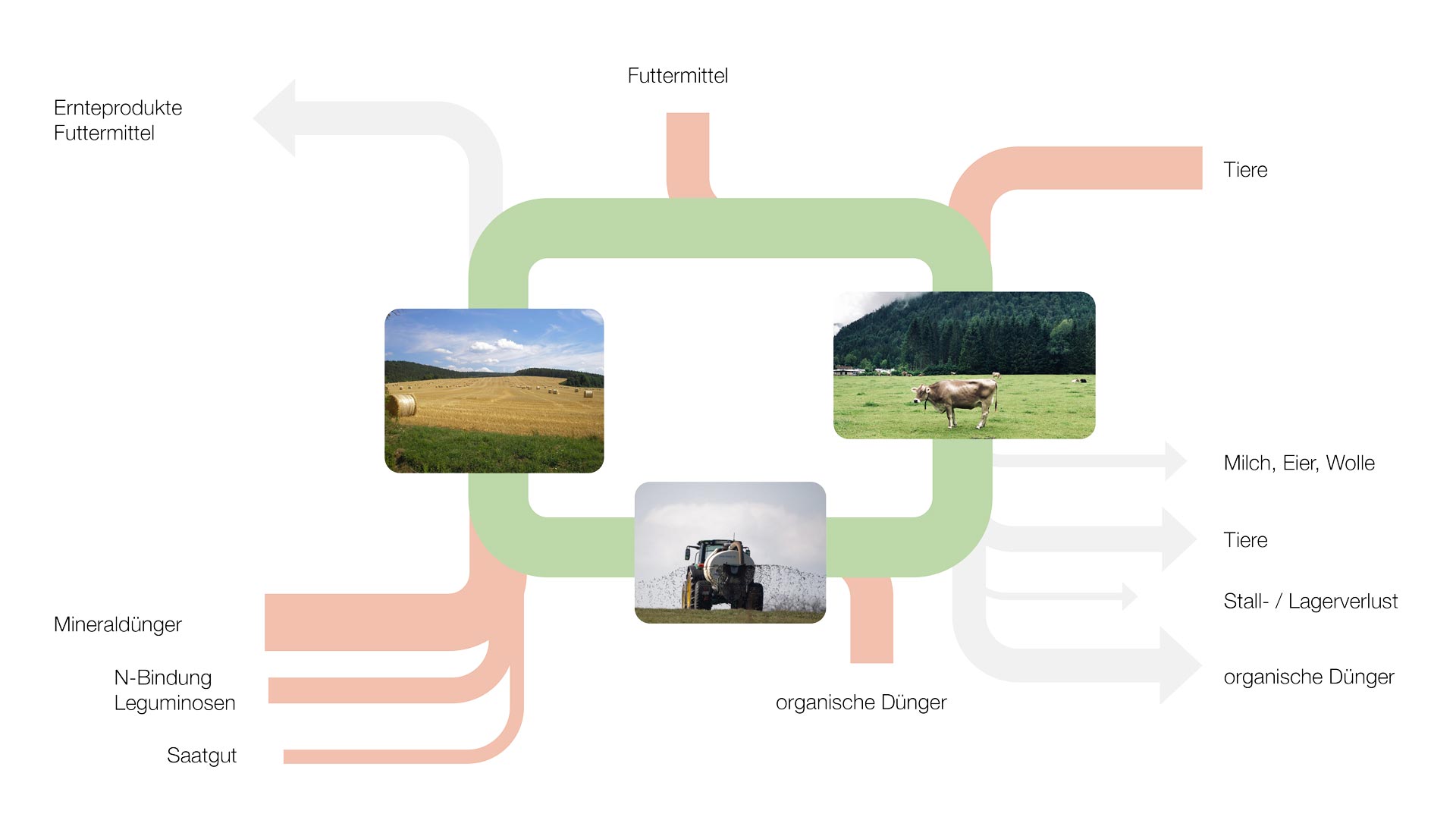
.png)
.png)